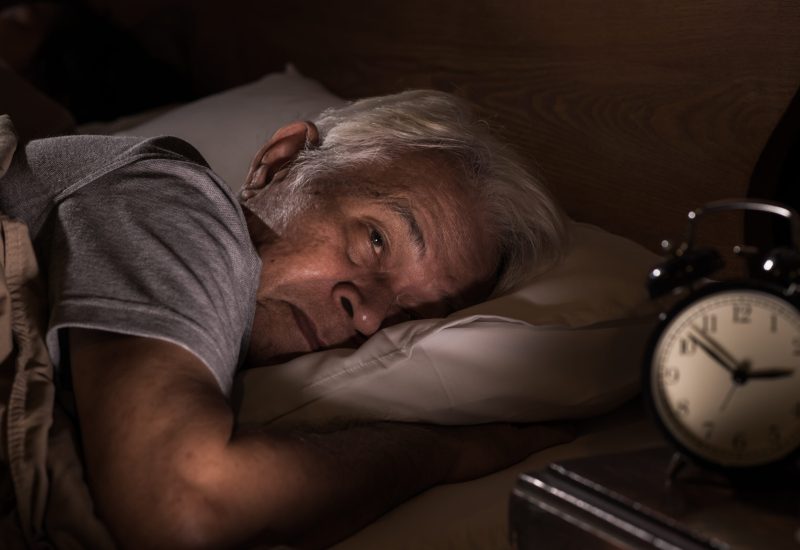Ein erholsamer Schlaf ist für unser körperliches und seelisches Wohlbefinden unverzichtbar. Doch gerade bei schwerkranken und sterbenden Menschen treten häufig Schlafstörungen auf, die die ohnehin belastende Lebenssituation zusätzlich erschweren. Die Ursachen sind vielschichtig – von körperlichen Beschwerden wie Schmerzen, über psychische Belastungen bis hin zu Umweltfaktoren. In diesem Beitrag beleuchten wir die wichtigsten Auslöser, die möglichen Folgen und konkrete Ansätze, um den Schlaf zu verbessern.
Ursachen von Schlafstörungen bei palliativen Patienten
1. Körperliche Beschwerden
Schmerzen
Chronischer Schmerz ist eine der häufigsten Ursachen für Ein- und Durchschlafstörungen. Auch akute Schmerzspitzen können die Nachtruhe empfindlich stören. Eine sorgfältige Schmerzeinstellung ist entscheidend. In der Regel erfolgt diese durch eine Kombination aus Dauer- und Bedarfsmedikation. Reicht die Dauermedikation nicht aus, kann eine zusätzliche Bedarfsmedikation helfen. Treten häufige Bedarfsgaben auf, sollte die Grundmedikation angepasst werden. Zum Einsatz kommen meist Opiate und Nicht-Opiate.
Hinweis: Federbetten können Schmerzen verstärken. Sie halten Wärme zurück, was bei Entzündungen die Schmerzintensität erhöhen kann. Außerdem ziehen Federn Feuchtigkeit an – sowohl aus der Raumluft als auch aus der Körperabgabe in der Nacht. Das kann ein feuchtes Schlafklima schaffen, das Schmerzen und Entzündungen zusätzlich begünstigt.
Unruhe
Unruhe am Lebensende ist weit verbreitet und kann viele Ursachen haben: unbehandelte körperliche Beschwerden, Ängste, Depressionen, Verwirrtheit, Delir oder unerledigte Angelegenheiten. Typische Anzeichen sind Unruhe in den Beinen, unwillkürliche Bewegungen, Nesteln, Zupfen, Wischen oder sogar unkontrollierte Armbewegungen.
Mögliche Maßnahmen:
- Medikamentöse Therapie – insbesondere Schmerzbehandlung, da Schmerz sich auch durch Unruhe äußern kann
- Ablenkung – Handschmeichler, Kuscheltiere oder spezielle interaktive Demenztiere (Hund, Katze, Bär) können beruhigen
- Behandlung von Juckreiz und trockener Haut – z. B. mit guter Hautpflege oder antipruritischen Medikamenten
Atemnot
Atemprobleme, etwa bei COPD oder Pleuraergüssen, führen nicht nur zu körperlicher Belastung, sondern auch zu Angst, die das Einschlafen erschwert.
Unterstützende Maßnahmen:
- Medikamentöse Therapie mit Opiaten, bronchienerweiternden oder angstlösenden Medikamenten
- Oberkörperhochlagerung oder andere atemerleichternde Positionen (z. B. „Kutschersitz“)
- Individuelle Positionierung, die das Atmen erleichtert
- Atem- und Entspannungsübungen zur Verbesserung der Atemtiefe und Angstreduktion
- Maßnahmen zur Sekretmobilisation – Hustentechniken, Lagerungen, Klopfmassagen
- Frische oder kühle Luft – durch offene Fenster, Ventilatoren oder sogar einen Fächer, den Patient oder Angehörige gezielt einsetzen können
- Vermeiden beengender Kleidung, ggf. BH entfernen
2. Psychische Belastungen
Die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit, Sorgen um die Familie oder der Verlust nahestehender Menschen belasten emotional stark. Gedankenkarusselle verhindern das Abschalten. Auch unerledigte Dinge können innerlich Unruhe verursachen. Hier kann es entlastend wirken, Angelegenheiten wie Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung zu regeln.
3. Umweltfaktoren
Ein Umzug ins Pflegeheim oder Hospiz bedeutet eine neue, oft ungewohnte Umgebung – mit fremden Geräuschen, anderen Lichtverhältnissen oder ungewohnten Betten. Zusätzlich verändert sich der Tagesablauf: Bettlägerigkeit oder fehlende Bewegung führen zu häufigen Ruhephasen am Tag und stören den Schlaf-Wach-Rhythmus. Das kann dazu führen, dass die Nacht unruhig oder schlaflos wird.
Folgen von Schlafstörungen
Schlafmangel wirkt sich auf mehreren Ebenen aus:
- Körperlich: Erschöpfung und Müdigkeit verschlechtern die allgemeine Belastbarkeit. Schmerzen, Atemnot oder Unruhe können sich verstärken.
- Emotional: Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit und geringere psychische Stabilität sind häufig.
- Teufelskreis: Schlechter Schlaf verstärkt Symptome, die wiederum den Schlaf beeinträchtigen.

Maßnahmen zur Verbesserung des Schlafs
1. Schlafhygiene
Schlafhygiene umfasst alle Maßnahmen, die für erholsamen Schlaf sorgen. Dazu zählen:
Schlafumgebung:
- Dunkelheit oder sanfte Lichtquelle – je nach individuellem Bedürfnis; ggf. Schlafmaske nutzen
- Ruhe oder gezielte Ablenkung – Ohrstöpsel, Musik, Hörbücher
- Angenehme Raumtemperatur – atmungsaktive Materialien wie Baumwolle oder Merinowolle wirken temperaturausgleichend und sind hautfreundlich
Schlafgewohnheiten:
- Gewohnte Rituale möglichst beibehalten
- Warme Arm- oder Fußbäder mit beruhigenden Zusätzen oder ätherischen Ölen
2. Ernährung und Bewegung
- Abends leichte Kost bevorzugen, aber Vorlieben berücksichtigen
- Soweit möglich, leichte Bewegung am Tag, um den Schlaf-Wach-Rhythmus zu stabilisieren
3. Stressmanagement und Entspannung
- Tagebuch führen – um Gedanken zu ordnen, Sorgen loszulassen oder Erinnerungen zu bewahren
- Natürliche Hilfsmittel – Wickel, Auflagen, ätherische Öle (Lavendel, Mandarine, Melisse) oder Heilpflanzen wie Baldrian, Passionsblume, Hopfen
Fazit
Schlafstörungen bei palliativen Patienten sind ein ernstzunehmendes Problem, das die Lebensqualität erheblich mindern kann. Die Ursachen sind meist vielschichtig – oft wirken körperliche, psychische und umgebungsbedingte Faktoren zusammen. Der Schlüssel liegt in einer individuellen, ganzheitlichen Herangehensweise, die sowohl medizinische als auch emotionale und umgebungsbezogene Aspekte berücksichtigt. Schon kleine Anpassungen können zu erholsameren Nächten und mehr Lebensqualität beitragen.